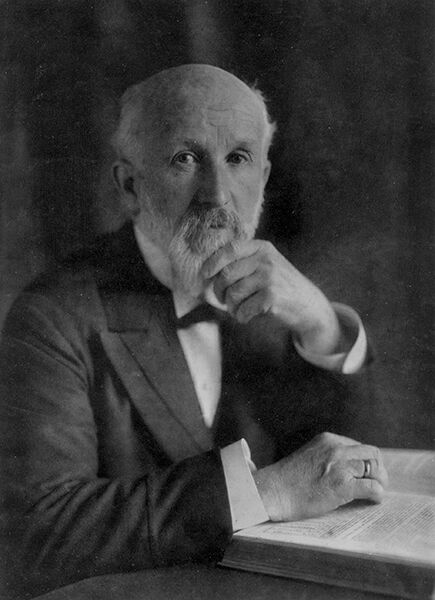Von Fuchs ging die Sammlungsaufsicht 1827 auf Emil Huschke über. Nachdem Goethe ihn schriftlich genauestens über den Aufbau und die Betreuung der Anatomischen Sammlung unterrichtet hatte, sorgte er fast 40 Jahre lang für deren Erhalt und Wachstum. Huschkes Forschungsinteressen, beispielsweise Embryologie und Schädelvermessung, sind bis heute am Sammlungsbestand ablesbar.
1858 bis 1938: Vergleichend-anatomische Lehrsammlung
1858 erfolgte der Umzug der menschlich-anatomischen, zoologischen und osteologischen Sammlungen aus dem Jenaer Schloss in das bis heute genutzte Anatomiegebäude am Teichgraben 7. Er ging mit einer gründlichen Durchsicht und auch Ausmusterung vieler Sammlungsstücke einher, zugleich wurden noch unter Huschke neue Sammlungsverzeichnisse angelegt. Erstmals waren die Bestände nach mehreren Abteilungen sortiert, die dem sich ausdifferenzierenden Lehrbetrieb Rechnung trugen, darunter eine sogenannte „Raçenschädel“-Sammlung, in der auch Gebeine von Opfern des europäischen Kolonialismus gesammelt wurden.